Was ist ein Haiku
俳句;
Gudrun Egner
„Faszination Haiku“, diese Charakterisierung der kürzesten Gedichtform der Welt, die ich einmal las, gilt auch für mich. Die Faszination lässt sich wohl nicht erklären, man kann sich ihr höchstens annähern, ihr im Glücksfall gar blitzartig begegnen – eben auf die Art und Weise, wie es einem Haiku eigen ist! Zur Annäherung möchte ich hier gerne – so gut als möglich in der vorgegebenen Kürze – beitragen, und vielleicht geschieht sie ja dann sogar in der Folge: jene faszinierende, erhellende und wünschenswerte Begegnung!
Die traditionelle Gedichtform kommt ursprünglich aus Japan und ist heute weltweit verbreitet.
Das japanische Haiku hat den geistesgeschichtlichen Hintergrund des Zens. Seine Weltsicht und seine Übungen entsprechen der Haltung, das Besondere im kleinsten Augenblick achtsam wahrzunehmen. Japanische Haiku bestehen meist aus drei Wortgruppen von 5 – 7 – 5 Lauteinheiten (Moren). Diese werden vertikal aneinandergereiht, wobei viele in kalligraphischer Form dargestellt sind. Charakteristisch sind hierbei Konkretheit und der Bezug auf die Gegenwart. Vor allem traditionelle Haiku deuten das Neujahr oder eine Jahreszeit an. Offene, nicht abgeschlossene Texte, die sich erst im Erleben des Lesers vervollständigen, sind ein weiteres Wesensmerkmal; im Text wird also nicht immer alles gesagt, Gefühle werden nur selten benannt. Sie sollen sich erst durch den Zusammenhang erschließen. Das Senryu jedoch, eine Abwandlung des Haiku, widmet sich auch dem Persönlichen, Emotionalen; formal sind beide identisch.
Im Deutschen werden Haiku meist dreizeilig geschrieben, die klassische Versvorgabe der Haiku-Poetik ist das Siebzehnsilbenmuster. Dass sich viele deutschsprachige Haijin (Haiku-Autoren) nicht mehr daran halten, ist Fakt, soll hier aber nicht Gegenstand der Erörterung sein.
Die dargestellten Dinge sind Repräsentanten erlebter Momente, abgebildet wird eine einmalige Situation oder ein einmaliges Ereignis. Dabei spiegelt die Natur die Seele, wobei ein Bild entsteht, das zum Symbol wird und den eigentlichen Kern des Haiku herauskristallisiert. Über die konkrete Natur
hinausgehend, verweisen einige Autoren auf weitergehende kulturspezifische Symbolik, denen religiöse, gesellschaftliche und philosophische Themen zugrunde liegen. In der dritten Zeile liegt oft ein Überraschungsmoment oder ein Rätsel, manchmal ähnlich einem Koan im Zen-Buddhismus
Eine Besonderheit stellt auch das gemeinsame Dichten – Waka (Antwortgedicht) dar. Verwandt mit dem Haiku ist das fünfteilige Tanka und das Renga, als eine Kette von Tanka.
Als der erste große Haiku-Dichter gilt Matsuo Basho (1644 – 1694) Sein Frosch-Haiku ist wohl das meistzitierte Haiku der Welt - es existiert in mehreren Übersetzungen:
Uralter Teich
Ein Frosch springt hinein
Plop. /1
Von Basho ist überliefert, dass er auf dem Totenbett vor seinen Schülern jenes letzte Haiku gesprochen hat:
„Am Ende meiner Reise,
meine Träume irren
durch das verblühte Moor.“ /2
Diese Aussage hat viele Künstler bewegt und inspiriert, u. a. auch Yoko Ono, die Lebensgefährtin von John Lennon.
Große Haiku-Dichter (der Edo-Zeit - Abschnitt der japanischen Geschichte von 1603 bis 1868) waren auch Buson und Kobayashi Issa. Issa war sehr eigenwillig und hielt sich oft nicht an die konventionelle Silbenform. Er drückt, oft humorvoll, besonders tiefe Liebe zu Mensch und Kreatur aus.
Wenn ich einst sterbe
So sei am Grabe Wächter
Vom Feld die Grille. /3
Das kleine Kätzchen
Am Waagebalken baumelt,
Der in die Luft ragt. /4
Davon ausgehend, dass für die LeserInnen an dieser Stelle vor allem die deutschsprachige Haiku-Dichtung von Interesse ist, folgen hier einige Hinweise in komprimierter Form von den Anfängen bis zur Gegenwart.
Deutsche Haiku gibt es erst seit 1900, zunächst nur vereinzelt, dann seit dem Zweiten Weltkrieg. Gründe dafür sind im Impressionismus, der von Frankreich seinen Ausgang nahm, und sich in allen Bereichen der Kunst
manifestierte zu finden, sowie in der allgemeinen Japan-Begeisterung um 1900 und nicht zuletzt die politische Lage nach dem Sieg Japans im russisch-japanischen Krieg 1904/05 weckten in Deutschland ein Gefühl geistiger Affinität, das unter anderem zur literarischen Nachahmung anregte. Die ersten deutschen Haiku sind in der Gedichtsammlung „Polymeter“ von Paul Ernst enthalten. Lyriker, deren Werk sog. Dreizeiler enthält, sind auch Peter Altenberg, Alfred Mombert und Arno Holz. Auch Rainer Maria Rilke hat den speziellen Erkenntniswert und die Poetik dieser Lyrikgattung sehr geschätzt und selber Dreizeiler verfasst; er kam dem Zen-Gehalt des japanischen Vorbildes sehr nahe.
Von Berthold Brecht ist folgender Text überliefert:
Der Bauer pflügt den Acker
Wer

Wird die Ernte einbringen? /5
Zu erwähnen sind auch deutschsprachige Haiku-Übersetzer, hier besonders Günter Eich, der auch ein namhafter Nachkriegslyriker und Haiku-Dichter war.
Eine herausragende Autorin ist die österreichische Schriftstellerin Imma von Bodmershof, deren Haiku-Dichtung im Jahr 1962 erschien. Aufschlussreich ist ihr Bekenntnis zur klassischen Haiku-Form:
„...als ich damals die ersten Haiku hrausgab, dachte ich noch, es sei erlaubt, mitunter 19 oder sogar 21 Silben (immer nur ungerade Zahlen, die geraden schließen ab, die ungeraden lassen dem Leser den Weg offen) und verwendete bei 60 von 128 Haiku diese Möglichkeit. Indessen bin ich ganz davon abgerückt. In der Zahl 17 ist eine Kraft enthalten, die durch nichts
anderes zu ersetzen ist. Unter Preisgabe einiger Nuancen habe ich die längeren Haiku dieses Bandes verkürzt.“ /6
Auch weist sie darauf hin, dass Form und Inhalt eine Einheit bilden, jene eigentliche Haiku-Komponente, die auch als Zen-Gehalt gelten kann.
„So leicht und flüchtig Haiku und Tanka, die japanischen Kurzgedichte, hingesetzt erscheinen – so streng sind sie durch ihr eigenes Gesetz bestimmt. Auch ohne Wissen von der japanischen Tradition wird das jedem deutlich, der sich in diese Gedichte einhört, in besonderer Weise aber dem, der es versucht, in seiner eigenen Sprache ähnliche Gebilde hervorzubringen“ /7
Wilhelm von Bodmershof:
Ehe die Nacht kommt
steigt der Falke zur Höhe.
Die Spatzen lärmen.
Imma von Bodmershof /8
Der große Fluss schweigt
manchmal nur tönt es leise
tief unter dem Eis
Imma von Bodmershof /9
Kranichzug am Berg -
sie wissen um Weg und Ziel.
Wohin wandern wir?
Marianne Junghans /10

Handwerkliche Mittel allein genügen selbstverständlich nicht. Für den Europäer ergibt sich ein Problem: Ihm ist die Geheimsprache von Haiku (und Tanka) nicht direkt zugänglich – sie erschließt sich nur einem empfindsamen Gehör. Der Pfad als solcher mag als verborgener Sinn gelten, dass nämlich, in Japan die Kunst der Kurzgedichte mehr als priesterliche denn als künstlerische Leistung gewertet wurde. Die meisten Könner dieser Kunst waren selbst Priester und Mönche oder lebten zumindest im Verzicht auf die Güter der Außenwelt und in der vollen Hinwendung zu den Gütern der Innenwelt. Hajin wurden diese Dichter genannt, das sind die, die sich mit der ewigen Leere vereinen. (Tao: Von außen gesehen die ewige Leere, von innen gesehen die ewige Fülle.)
Eine gründliche Interpretation der Haiku verlangt schließlich noch die Kenntnis der tragenden Symbole:
Der Mond
Gleichbedeutend etwa „dem Fünklein“ der mittelalterlichen christlichen Mystiker.
Die Kirschblüte
Symbol für das seelische, geistiges Licht empfangendes Zentrum im Menschen.
Der Regen
Das Wasser als das dem Licht entgegengesetzte Prinzip, von oben nach unten stürzend. Symbol für den Tod.
Der Garten
Das Innere des Menschen.
Das Haus
Der irdische Leib.
Die Wildgans
Symbol für den Priester-Pilger, der das ferne jenseitige Land erreicht.
Der Schmetterling
Die sich in Herrlichkeit verwandelnde Raupe. Symbol für den geistigen, ewigen Menschen.
Der Kuckuck
Der aus dem Verborgenen dumpf rufende Vogel, Todesmahnung.
Die Amsel
Der zugleich mit dem Frühling die Auferstehung kündende Vogel.
Der Fuji
Der heilige Berg. Wohnstatt der Götter
_________________________________________
Für weiterführende Information verweise ich gerne auf die „Deutsche Haiku-Gesellschaft e.V. (DHG), die laut Satzung das Haiku ins Zentrum ihrer Aktivitäten stellt:
„Die besondere Sorge des Vereins gilt der Bewahrung und Förderung des eigenständigen Haiku, seiner Verbreitung und Pflege im deutschen Sprachraum.“
Hamburg, 06.02.2020
________________________________________________
Quellennachweise:
1 – 4: Haiku – Japanische Dreizeiler / Reclam
7: Haiku – Wilhelm von Bodmershof / dtv
6, 8, 9: Haiku – Imma von Bodmershof / dtv
5, 10: Sabine Sommerkamp „Die deutschsprachige Haiku-Dichtung“
Archiv Essays








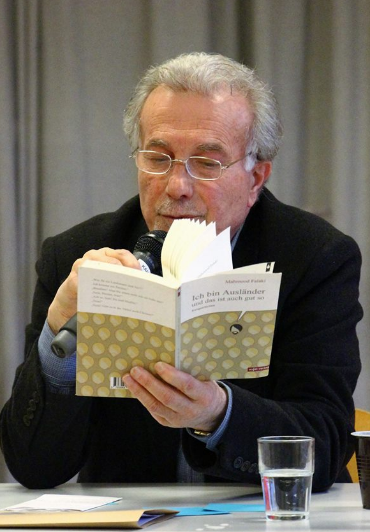
برای ارسال نظر وارد شوید